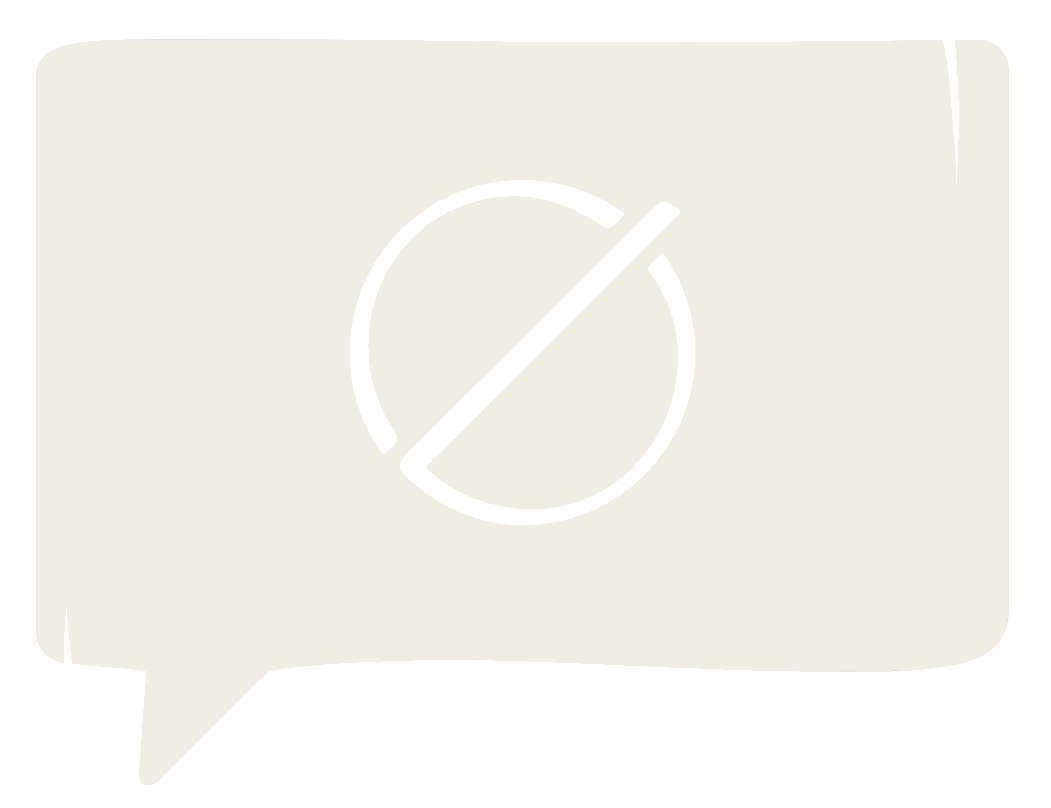Schlagwort: Heyne
-
Hörbuch: Blutige Nachrichten von Stephen King
Machen wir’s kurz: Seit knapp 20 Jahren lese (und höre) ich Stephen King und immer wieder bin ich neu begeistert. Dabei sind es manchmal knapp 1500 Seiten, manchmal nur 64. Blutige Nachrichten beinhaltet vier Novellen, und wie seit Jahren liest David Nathan auch diese. Allein seine Stimme bringt mich zurück in die Welten von Stephen…
-
Roman: Später von Stephen King
Ich fange nicht gern mit einer Rechtfertigung an – wahrscheinlich gibt es dagegen sogar eine Regel wie die, einen Satz nie mit einer Präposition enden zu lassen -, aber nach dem Durchlesen der 30 Seiten, die ich bisher geschrieben habe, glaube ich, das tun zu müssen. Der erste Satz aus Später Über diesen Anfang musste…
-
Hörbuch: Der Outsider von Stephen King, gelesen von David Nathan
Das Zivilfahrzeug war ein unauffälliger, schon etwas älterer PKW, aber die breiten schwarzen Reifen und die drei Insassen verrieten, worum es sich handelte. Der erste Satz aus der Outsider Ein vergewaltigter und ermordeter Junge, ein Tatort voller Fingerabdrücke und DNA und eine ganze Menge Zeugen. Aus der Sicht der Polizisten ein ganz klarer Fall. Aber…
-
Roman: Walkaway von Cory Doctorow
Hubert Vernon Rudolph Clayton Irving Alva Anton Jeff Harley Timothy Curtis Cleveland Cecil Ollie Edmund EliWiley Marvin Ellis Espinoza war zu alt, um auf einer kommunistischen Party zu sein. Der erste Satz aus Walkaway In einer Welt, in der man fast alles mit Sonnen- und Windenergie, einem 3D-Drucker und den richtigen Plänen ausdrucken kann, sind…
-
Roman: Artemis von Andy Weir
https://www.instagram.com/p/BhqZVitgb4D/?taken-by=jahfaby Der erste Satz aus Artemis: Ich sprang über das graue, staubige Gelände zur riesigen Wölbung der Conrad-Blase. Jazz lebt in Artemis, in der einzigen Stadt auf dem Mond, eigentlich nicht mehr als eine Raumstation für 2000 Einwohner und die Touristen. Jazz ist die geduldete Schmugglerin und alles ist einigermaßen okay, bis sie sich als…
-
Roman: Fireman von Joe Hill
https://www.instagram.com/p/BWKSM2cFAUT/ Der erste Satz aus Fireman: Wie jeder hatte auch Harper Grayson im Fernsehen schon viele brennende Menschen gesehen, doch das erste Mal, dass jemand direkt vor ihren Augen in Flammen aufging, war auf dem Pausenhof der Schule. Eine Pandemie hat die ganze Welt verseucht. Jeder der sich mit diesen Pilzsporen ansteckt, bekommt Feuermale am…
-
Roman: Fahrenheit 451 von Ray Bradbury
https://www.instagram.com/p/BFL90DQopih/ Der erste Satz aus Fahrenheit 451: Es war eine Lust, Feuer zu legen. Eines der Bücher, die ich immer als „das sollte ich irgendwann noch lesen“ abgespeichert hatte, aber nie dazu gekommen bin. Dann auf einer der Fahrten, die länger dauern, als gedacht, war das Buch, das ich eigentlich dabei hatte, ausgelesen und in…
-
Roman: Red Rising von Pierce Brown
https://www.instagram.com/p/BFa6Gztopt_/ Der erste Absatz aus Red Rising: Ich hätte in Frieden leben können. Aber meine Feinde brachten mir den Krieg. Darrow lebt unter der Oberfläche des Mars, er weiß, sein Volk muss in den Minen leben und sterben, damit der Mars irgendwann bewohnbar ist. Ein Dienst an die Menschheit. Bis er bemerkt, dass der Mars…
-
Roman: Red Rising von Pierce Brown
https://www.instagram.com/p/BFa6Gztopt_/ Der erste Absatz aus Red Rising: Ich hätte in Frieden leben können. Aber meine Feinde brachten mir den Krieg. Darrow lebt unter der Oberfläche des Mars, er weiß, sein Volk muss in den Minen leben und sterben, damit der Mars irgendwann bewohnbar ist. Ein Dienst an die Menschheit. Bis er bemerkt, dass der Mars…