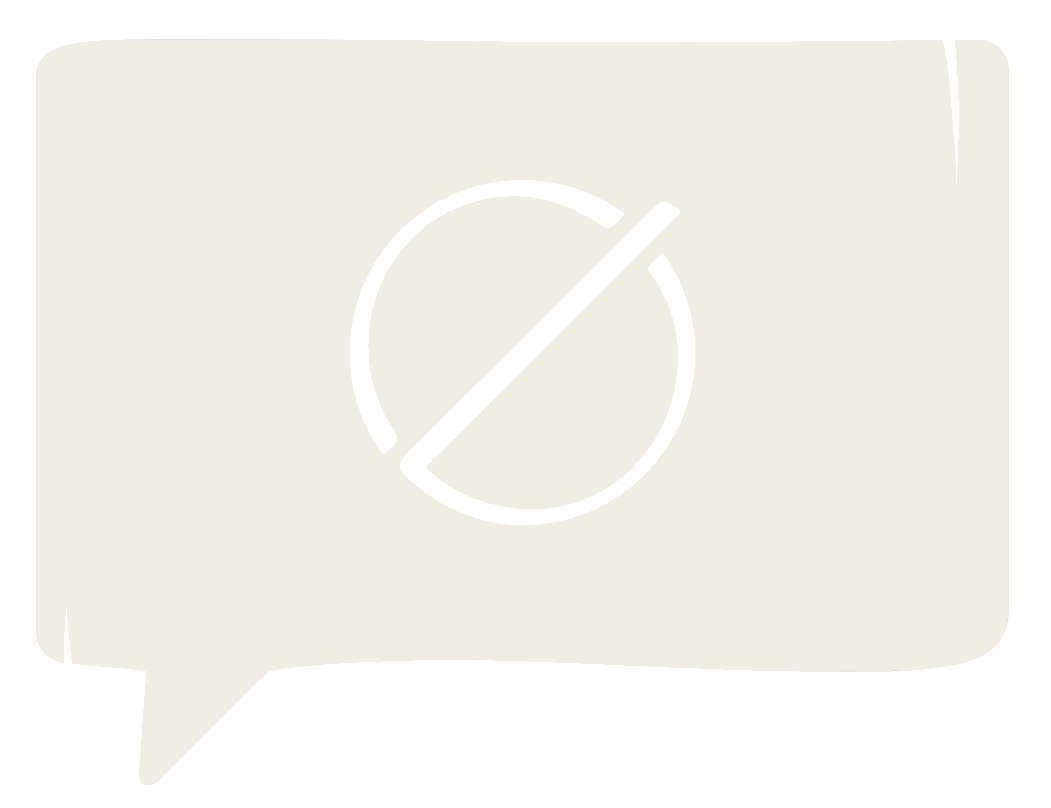Schlagwort: Nina George
-
Wie Nina George und der VS unser Internet kaputt machen
Das EU-Parlament hat für eine dubiose Urheberrechtsreform gestimmt, und ich finde es ziemlich scheiße, weil es komplett gegen meine Vorstellung von einem freien Internet und von Kreativität geht. Noch viel schlimmer aber ist die Freude von Nina George und des Verbands der Schriftsteller (VS). Vor zwei Jahren hielt Nina George eine Rede bei den Leipziger Buchtagen, die…
-
Kommentar zu "Wa(h)re Worte" – Nina Georges Rede bei den Buchtagen 2016 in Leipzig.
Vor ein paar Tagen fanden in Leipzig die Buchtage statt, bei deren Eröffnung die Autorin Nina George eine Rede gehalten hat, die mittlerweile durch die sozialen Netzwerke zieht. Dabei geht es um den Wert von Worten, symbolisch, aber auch ganz substanziell. Mir geht es gar nicht darum, ob ich mit Frau George einer Meinung bin.…