https://www.instagram.com/p/BW7NFeiFeFH/
Text und Interview erschienen zuerst in Drift – Zeitschrift für Recherchen, Ausgabe 1. Veröffentlichung hier erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers. Mehr Info zu Drift gibts unter dem Text.
Ulrich Blumenbach ist literarischer Übersetzer aus dem Englischen und arbeitet gerade am Großprojekt Witz von Joshua Cohen (Vier neue Nachrichten und Solo für Schneidermann, dt. von Ulrich Blumenbach) und den noch unübersetzten Essays von David Foster Wallace. Er war an der Übertragung von James Joyce Finnegans Wake beteiligt und wurde spätestens mit seiner Arbeit an Wallace‘ Roman Infinite Jest zur Berühmtheit. In einem Beispiel zeigt er uns, wieso und spricht im Anschluss über Explosionen, Genauigkeitsfetischismus und seine Haltung zu Übersetzung und Gegenwartsliteratur allgemein.
David Foster Wallace’ Roman Infinite Jest spielt hauptsächlich an zwei Orten, in der Enfield Tennis Academy in einem fiktiven Stadtteil von Boston, wo Jugendliche für eine Karriere im Profisport trainiert werden, und in der Entzugsanstalt Ennet House. Die Patienten der Entzugsanstalt haben die Auflage, je nach der Droge, von der sie loskommen wollen, an Treffen der jeweiligen Selbsthilfegruppen teilzunehmen. Wer einst dem Sumpfsinn frönte, geht also zu Treffen der Anonymen Alkoholiker. Die Anonymen Alkoholiker werden trotz all ihrer oft parodierten Sektenhaftigkeit zu einem, wenn nicht zu dem positiven Sinnzentrum des Romans. Alles andere wird nach guter alter Postmodernistenweise durch die Ironiemühle gedreht, aber da die Rituale der Anonymen Alkoholiker auf paradoxe Weise in sich gebrochen sind, können sich bei ihnen fragmentierte, dafür aber wieder handlungsfähige Subjekte mit eigener Willenskraft herausbilden. Erst wenn man die alte, suchtverleugnende Identität über Bord geworfen und eingesehen hat, dass man Alkoholiker ist, kann man hoffen, trocken zu werden. Zum paradoxen Programm der Selbsthilfegruppe gehört es, die Verlogenheit der Beichtrituale bei den Gruppentreffen zu kennen und sie trotzdem zu praktizieren. Gerade diese Ambivalenz trägt zum Erfolg bei. Wenn ich trotz innerer Ablehnung nur lange genug das Spiel mitspiele, allmorgendlich Gott um Hilfe dabei zu bitten, ohne Alkohol durch den Tag zu kommen, dann wird aus dem Spiel irgendwann Ernst. Dann will ich irgendwann nüchtern bleiben, und im nächsten Schritt kann ich dann irgendwann nüchtern bleiben. Wallace beschreibt immer wieder Gruppentreffen der Anonymen Alkoholiker, und die dort vorgebrachten Geständnisse trockengelegter Trinker gehören zu den finstersten Passagen des Romans, die gleichwohl oft eine Art trojanischen Humor bergen. Der folgende Abschnitt wird von einem irischen Einwanderer erzählt, der einen so breiten Dialekt spricht, dass man zunächst fast gar nichts versteht:
’d been a confarmed bowl-splatterer for yars b’yond contin’. ’d been barred from t’facilities at o’t’ troock stops twixt hair’n Nork for yars. T’wallpaper in de loo a t’ome hoong in t’ese carled sheets froom t’wall, ay till yo. But now woon dey … ay’ll remaember’t’always. T’were a wake to t’day ofter ay stewed oop for me ninety-dey chip. Ay were tray moents sobber. Ay were thar on t’throne a’t’ome, yo new. No’t’put too fain a point’on it, ay prodooced as er uzhal and … and ay war soo amazed as to no’t’belaven’ me yairs. ’Twas a sone so wonefamiliar at t’first ay tought ay’d droped me wallet in t’loo, do yo new. Ay tought ay’d droped me wallet in t’loo as Good is me wetness. So doan ay bend twixt m’knays and’ad a luke in t’dim o’t’loo, and codn’t belave me’yize. So gud paple ay do then ay drope to m’knays by t’loo an’t’ad a rail luke. A loaver’s luke, d’yo new. And friends t’were loavely past me pur poewers t’say. T’were a tard in t’loo. A rail tard. T’were farm an’ teppered an’ aiver so jaintly aitched. T’luked … conestroocted instaid’ve sprayed. T’luked as ay fel’t’in me ’eart Good ’imsailf maint a tard t’luke. Me friends, this tard’o’mine practically had a poolse. Ay sted doan own m’knays an tanked me Har Par, which ay choose t’call me Har Par Good, an’ ay been tankin me Har Par own m’knays aiver sin, marnin and natetime an in t’loo’s’well, aiver sin.
Um zu verstehen, worum es in dieser Passage überhaupt geht, habe ich sie zunächst in ein unmarkiertes Standarddeutsch übersetzt – was schon eine Weile dauerte, weil ich zunächst
beispielsweise nicht verstanden habe, was mit dem vermaledeiten »Har Par« in den letzten Zeilen bloß gemeint sein sollte. Die standarddeutsche Version lautete schließlich folgendermaßen:
Ich war seit unzähligen Jahren ein amtlich beglaubigter Kloschüsselbespritzer. Bei den Trucker-Raststätten zwischen hier und New York durfte ich schon seit Jahren nicht mehr auf die Toilette. Zu Hause war die Tapete an der Badezimmerwand schon total wellig, das kann ich euch sagen. Aber dann auf einmal … den Tag vergess’ ich mein Lebtag nicht. Da fehlte nur noch eine Woche, und ich war neunzig Tage trocken. Drei Monate war ich nüchtern. Ich hock’ da also zu Hause auf dem Donnerbalken, ja. Bin da am Drücken wie immer, da beißt die Maus keinen Faden ab und … und ich war so verdattert, ich hab’ meinen Augen nicht getraut. Das hatte ich so lange nicht gesehen, dass ich erst gedacht habe, mir wär das Portmonnaie ins Klo gefallen, ja. Echt, ich hab gedacht, mir ist das Portmonnaie ins Klo gefallen, so wahr mir Gott helfe. Ich geh’ also in die Knie und seh’ mir das im Zwielicht des Badezimmers richtig an, und ich hab’ meinen Augen nicht getraut. Das muss man sich mal vorstellen, Leute, ich knie’ neben der Toilette und seh’ mir das richtig an. Wie man einer Geliebten tief in die Augen blickt, ja. Und meine Freunde, das war eine Lieblichkeit, da fehlen mir die Worte. Da lag eine richtige Wurst im Klo. ’Ne richtige Wurst. Die war fest, verjüngte sich und war ganz leicht gebogen. Sie sah … wohlgeformt aus statt gespritzt. Sie sah so aus, dass ich das Gefühl hatte, Gottvater persönlich hätte die Wurst erschaffen. Meine Freunde, diese meine Wurst hatte praktisch einen Puls. Ich bin also auf den Knien geblieben und habe meinem Höheren Wesen gedankt, das ich immer Gott nenne, und seit dem Tag dank’ ich meinem Höheren Wesen auf den Knien, morgens, abends und auch auf dem Klo.
Angelsächsische Dialekte werden von deutschen ÜbersetzerInnen schon seit einigen Jahrzehnten nur noch selten durch deutsche Dialekte ersetzt. Da es hier jedoch nur um eine kurze Passage geht, habe ich es mir trotzdem erlaubt und die Passage zunächst in ein geo- graphisch nicht lupenrein zuzuordnendes Norddeutsch übersetzt, wie es in Hamburg und meiner niedersächsischen Heimat anzutreffen sein dürfte:
Ich hadde seid zich Jaahn jesusmäßich die Renneridis. Bein Raststäddn zwischen hier und Njork durfd ich schon seid zich Jaahn nich mehr aufn Podd. Zu Hause die Tapede anna Wand vom Lokus war schon wellig wie Hulle. Aber dann aufn Mal … den Tach vergess ich mein Lebtach nich. Da fehlde nur noch ne Woche, ne, und ich war neunzich Tage troggn. Drei Monade wah ich nüchtann. Ich hock da also zu Hause aufm Donnabalkn, ne. Bin da am Machen wie immer, da beißd die Maus keinn Fadn ab und … und ich wah sowas von verdaddad, dassde midn Oahn schlaggast. Das hadd ich so lange nich gesehn, dass ich east gedacht hab, mir wärs Pordmoneh inn Lokus gefalln, ne. Echd, ich hab gedachd, mir isses Pordmoneh inn Lokus gefalln, so wah mir Gott helfe. Ich also in die Knie und seh mir das im Schummer vom Lokus richdich an, und da schlagga ich erst recht midn Oahn. Muss man sich ma vorstelln, Loide, ich knie nebem Lokus und seh mir das richdich an, wie unna na Lupe. Seh mir das an wie ne Geliebte, ne. Und meine Froinde, das war ne Lieblichkeid, da bleibd eim die Spugge wech. Da laach ne richdige Wuasd im Lokus. Ne richtige Wuasd. Die war fest, vajüngde sich und war gans leichd gebogn. Sie sah … wohl- geformd aus statt gespritzt. Sie sah aus, dass ichs Gefühl hadde, Godd selbsd hädde die Wuast erschaffn. Meine Froinde, diese meine Wuasd zwinkate mir praktisch zu. Ich also aufn Knien geblieben und dank meim Hören Wesen, das ich imma Godd nenn, und seid dem Dach dank ich meim Hören Wesen aufn Knien, morgens, ahms und aufm Lokus.
Das Ergebnis mag in sich stimmig sein, aber wenn ein irischer Einwanderer ins US-amerikanische Boston einen norddeutschen Dialekt spricht, schubst das den Leser aus der Fiktion, seine willing suspension of disbelief gerät an ihre Grenzen. Außerdem ist diese Passage noch viel zu verständlich. Wenn ich wirklich die für literarische Übersetzungen so wichtige Wirkungsäquivalenz erzielen will, muss ich die Übersetzung an dieser Stelle unverständlicher machen, da auch das Original für nichtirische Englischsprecher unverständlich ist. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich mich gefragt, warum muss das eigentlich ein irischer Immigrant sein? Kann der nicht auch aus der Schweiz, genauer gesagt aus Basel kommen? Ich habe also die Nationalität des Sprechers geändert, mich mit einem Freund, Lucas Burkart vom Historischen Seminar der Universität Basel, zusammengesetzt, und herausgekommen ist die folgende Fassung, wie sie jetzt im Buche steht:
Als aine, wo alli Aabeehysli versprützt, bin ych scho männgs Joor bekannt gse. In de Beize uff de Landstroosse han ych scho lang nimme uff d’ Schissi deerfe. Deheim, im Bad isch d’ Dabeete scho so wällig gse, das glaubsch gar nit. Aber denn uff aimool … das wird ych nie vergässe. Ai Wuche no, und ych hätt niinzig Tag nimme gsoffe. Drei Moonet wär ych denn undrungge gse. Also ich hogg dehaim uff dr Schissi, verstoosch. Bi am Drugge wie allewyl, das glaubsch gar nit, und … und bi so verstuunt gse, ych ha myne Auge nit traut. Das han ych scho lang nimme gsee, do han ych zerscht dänggt, ’s Portemonnaie isch mir ins Hysli gfalle, verstoosch. By Gott, ych han dänggt, ’s Portemonnaie isch mir ins Hysli gfalle. Ych kneule also aane und lueg mir die Sach im schummrige Liecht vom Hysli ganz genau aa. Ych ha myne Auge nit traut, versteend ihr, Lyt, ich kneule also näbem Haafe und lueg ganz gnau. Grad soo wie me emene Schatz in d’ Auge luegt. Miini Frynd, das isch e Fraid gse, mir fäle d’ Wort. Do lygt e richtig Wirschtli. E richtig Wirschtli. Feschd, spitzig und lycht krumm. Es hett ussgseh wie ne Wirschtli, gar nimme verspritzt. Graad eso als ob dr liebi Gott ʼs gmacht haig. Also miini Fründ, das Wirschtli hett fascht wie gläbt, Ych bi also kneule blybe und ha mym Heechere Wäse danggt, das Wäse wo fir my dr liebi Gott isch, und sit däm Tag dank ych däm Heechere Wäse uff de Kneu, am Morge, am Oobe und uff em Hysli. (US 507f.)
Dokumentation einer vielgliedrigen Frage-Antwort-Relation mit losem Bezug zum abgedruckten Textbeispiel – oder: Nennen wir es Interview.
1. Eine Welt, die Sprache macht
Grundsätzlich und vor allem Anderen gesagt: Durch Sprache erfassen wir die Welt. Wittgenstein schreibt im Tractatus logico-philosophicus: »Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.« Ich habe den Wunsch (und ich nehme an, viele Menschen teilen ihn), meine Welt besser zu verstehen. Also möchte ich ihre Grenzen ausweiten, indem ich lerne, sie sprachlich besser auf den Begriff zu bringen. Literatur hilft dabei. Wallace war für mich eine Offenbarung, weil sein sprachlicher Genauigkeitsfetischismus neue Welten erschließt.
2. Wie es sich zusammenreimt
Erst einmal habe ich mir die [oben ab- gedruckte, Anm. d. Red.] unverständliche anglo-irische Passage immer wieder vorgelesen, weil mir schwante, dass ich irgendwelcher phonetischer Verzerrungen wegen auf dem Schlauch stand. An dieser Stelle, bei diesen beiden Wörtern, also »Har« und »Par«, habe ich daher nicht groß recherchiert, sondern irgendwann ist einfach der Groschen gefallen; im Kontext der spezifischen Spiritualität der Anonymen Alkoholiker konnte es nichts anderes bedeuten als »Higher Power« / »Höheres Wesen«.
Verständlich? Finden Sie »Heechere Wäse« wirklich so verständlich? Damit dürften Sie ziemlich allein stehen. Mir blieb nach der Vorabentscheidung, die Passage ins Baseldytsch zu übersetzen, keine andere Wahl.
3. Sich Freiheit gönnen
Die einzige Reaktion darauf, an die ich mich erinnern kann, war die skep- tische Nachfrage, ob man die Nationalität einer literarischen Figur ändern dürfe, denn das sei doch ein massiver Eingriff in das Werk. Ein gewichtiger Einwand, aber hier hielt und halte ich mein Verfahren für legitim, weil die Passage in Infinite Jest so heraussticht, und dann muss man, wie Fritz Senn beim Zürcher Übersetzertreffen in der Joyce-Stiftung immer sagt, in der Übersetzung etwas veranstalten, damit die Leser merken, welche Dynamik der Text entfaltet. Kurz gesagt: Das muss kesseln!
4. Die Reihenfolge – Recherche und Übersetzung
Realia recherchiere ich möglichst sofort, also bei der ersten Rohübersetzung, denn der Sachgehalt beeinflusst unter Umständen den Wortlaut. Zitate, deren deutsche Entsprechungen ich nicht im Internet finde, sammle ich in der Regel und lege dann irgendwann einen Recherchetag in der Basler Unibibliothek ein. Experten frage ich erst, wenn ich allein nicht mehr weiterkomme, mit meinem Latein am Ende bin.
Auch der eigentlich kreative Teil des Übersetzens findet schon beim Rohübersetzen statt, habe ich festgestellt. Als erstes schlage ich Vokabeln bei www.dict.cc und www.linguee.de nach, wenn mich die dortigen Wortangebote nicht befriedigen, trete ich ans Regal und konsultiere das Pons-Großwörterbuch und den Großen Muret-Sanders, suche aber auch schon in meinen privat angelegten Synonymlisten nach idealen Ausdrücken. Auch Wortspiele drechsle ich – zumindest wenn ich ruhig und entspannt übersetze –, bevor ich zu tippen anfange, bevor Sätze eine grammatische Form annehmen.
Der Rhythmus einer Passage dagegen, habe ich – selber leicht verblüfft – festgestellt, bildet sich manchmal erst beim ersten Überarbeiten am folgenden Tag heraus.
5. Eindeutig Kompensiert
Es gibt unübersetzbare Wörter (das Englische kennt beispielsweise den schönen Ausdruck »petrichor«, der den lehmigen Geruch bezeichnet, der nach einem Sommerregen vom zuvor ausgetrockneten Erdboden aufsteigt), aber zum Glück gibt es das Prinzip des kompensierenden Übersetzens, d.h. wenn ich auf ein tatsächlich unübersetzbares Wort stoße, versuche ich, in seiner Satzumgebung einen ähnlichen Effekt zu erzeugen und vielleicht ein im Deutschen ähnlich auffälliges Wort einzubauen.
6. Ein Riese und der Weg dorthin
Meine Recherche geht so weit, bis ich mit einer gefundenen Lösung zufrieden bin und glaube, das Wort angemessen übersetzt zu haben. Das kann dauern. Wallace beschreibt in Infinite Jest beispielsweise einen Mann als ascapartic. Der Ausdruck stand jahrelang in meiner Fragenliste ungeklärter Wörter und Begriffe, denn das Oxford English Dictionary kannte ihn ebenso wenig wie der große Muret-Sanders von 1962 und das Webster’s Unabridged Dictionary. Durch puren Zufall habe ich in einem Antiquariat den Muret-Sanders in der Ausgabe von 1906 gefunden, und da stand dann endlich: »Ascapart«: »in alten Romanzen ein gewaltiger Riese, den Bevis of Hampton besiegte«. Ich bin (mehr aus philologischem als aus übersetzerischem Interesse) dem Eigennamen »Ascapart« nachgegangen und habe Verweise auf William Shakespeares in den Jahren 1590-92 entstandene Historie The Second Part of King Henry VI gefunden. In den gängigen Werkausgaben von heute ist die Passage aber nicht aufzufinden, und man muss bis zur Quarto-Ausgabe von 1594 zurück gehen, in der es in der Tat heißt: »As Beuys of South-hampton fell vpon Askapart«. Die Anspielung auf den Helden der in der Renaissance noch beliebten Romanzen war für spätere Zuschauer unverständlich und wurde in späteren Textausgaben daher gestrichen.
7. Richtig falsch übersetzen
Ich fürchte, es ist unergiebig, die Frage nach dem Vorgehen beim Recherchieren an den Aspekt der Figurenreden zu koppeln. Was Hal Incandenza angeht, den Jugendlichen mit dem photographischen Gedächtnis, der das Oxford English Dictionary auswendig lernt, so musste ich, um seinen Wortschatz adäquat zu übersetzen, enzyklopädische Wörterbücher aller möglichen Wissensgebiete konsultieren. Das ist letztlich aber eine Selbstverständlichkeit allen literarischen Übersetzens und wird im Fall von David Foster Wallace und Infinite Jest allenfalls quantitativ noch einmal gesteigert.
Wenn Sie mich nach Figuren fragen, die mich am meisten amüsiert, belehrt, gefordert und/oder befreit haben, fallen mir gleich zwei ein, nämlich der frankokanadische Terrorist Rémy Marathe, der ein nur unvollkommenes Englisch spricht, und der kokainsüchtige Dealer Randy Lenz, der den Intellektuellen markiert, sprachlich über seine Verhältnisse lebt und einen Schnitzer nach dem anderen produziert. Beider Redeweise wird durch Malapropismen und Artverwandtes charakterisiert, und Falsches richtig falsch zu übersetzen, ist eine Kunst für sich. Marathe wird beispielsweise nicht durch eine fehlerhafte Aussprache markiert wie Franzosen oft im Klischee, sondern verfehlt haarscharf die gemeinten idiomatischen Ausdrücke, wenn jemand für brutale Tätigkeiten nicht mehr »abgegart« (statt »abgebrüht«) genug ist oder wenn ein »Sündenwidder« gesucht wird. Und wenn Randy Lenz das ihm unbekannte Fremdwort bonafide (im Kontext etwa »waschecht«) als »bonerfied« verballhornt, steckt in der Schreibung ein boner, eine Erektion, was ich kompensierend nachgeahmt habe, indem ich Lenz an anderer Stelle statt von Geysiren auf Island von »Geishas auf Island« sprechen und aus regeneriert »regenerigiert« machen lasse.
8. Interpretation am Fall des Zaunkönigs
An einem anderen Beispiel lässt sich vielleicht eher und fruchtbarer demonstrieren, wie und warum ein Übersetzer beim Recherchieren vom Hundertsten ins Tausendste kommen kann. Die Situation: Der Footballspieler Orin Incadenza – der Bruder des Tennisspielers Hal Incandenza – sitzt in Phoenix im amerikanischen Bundesstaat Arizona in der prallen Sonne und badet sein schmerzendes Bein in einem Whirlpool, und dann heißt es: »Urplötzlich war Knall auf Fall ein Vogel in den Whirlpool geplumpst. Mit einem nichtssagenden, nüchternen Plop. Knall auf Fall. Aus dem weiten leeren Himmel. Über dem Whirlpool war nichts als Himmel. Der Vogel musste mitten im Flug einen Herzinfarkt erlitten haben, gestorben, aus dem leeren Himmel gefallen und tot direkt neben dem Bein im Whirlpool gelandet sein. Mit einem Finger schob Orin die Sonnenbrille auf die Nase und betrachtete ihn. Der Vogel hatte nichts Besonderes. Kein Raubvogel. Ein Zaunkönig vielleicht.«
Ein ornithologisch bewanderter Freund entdeckte hier eine Unstim- migkeit. Zumindest der europäische Zaunkönig nistet in niedrigen Sträu- chern, fliegt tief über dem Boden und – im Zusammenhang des Romans das Wichtigste – überquert im Flug niemals Wasserflächen. Nun könnte man natürlich argumentieren, dass ein Whirlpool nicht unbedingt als flugroutenbehindernde Wasserfläche gewertet werden muss. Ich bin der Frage trotzdem nachgegangen und habe die Bedenken in einem Diskussionsforum von Wallace-Lesern und -Fans geäußert. Die Antworten waren hochinteressant – und führten in ganz verschiedene Richtungen. Die erste Mail kommentierte nur kurz und bündig: »My vote is for the cactus wren« (Kaktuszaunkönig oder Campylorhynchus brunneicapillus). Als ich dem Hinweis bei Wikipedia nachging, entdeckte ich, dass der Kaktuszaun- könig der Staatsvogel von Arizona ist. Heureka!, dachte ich: Wallace arbeitet mit einer Anspielungstechnik, wie sie vor hundert Jahren von Autoren der klassischen Moderne wie James Joyce, Ezra Pound und T.S. Eliot entwickelt wurde: Die tiefere Bedeutung eines unscheinbaren Oberflächensignals dient der Figurencharakterisierung, denn wenn ein Footballspieler, der zur Mannschaft der Phoenix Cardinals gehört, in dieser Situation an das Wappentier seines Bundesstaates denkt, zeugt das von seiner Loyalität, er identifiziert sich mit seiner Mannschaft und über sie mit dem Bundesstaat, in dem er lebt.
Der Verfasser einer der wenigen bislang vorliegenden Monographien zu Infinite Jest vermutete dagegen eine spielerische Homophonie des Autors: Der Zaunkönig heißt auf englisch wren, und a wren klingt fast wie Orin, der Name unseres Footballspielers am Pool.
Wie besorge ich mir also Informatio- nen? Indem ich bei Wikipedia recherchiere und die geballte Kompetenz der Experten anzapfe, die sich in spezifischen Diskussionsforen organisiert haben. Aber was nützen mir die auf diese Weise gewonnenen Informationen? In der Übersetzung kann ja doch nur vom »Zaunkönig« die Rede sein, denn weder darf ich Orins mangelndes Wissen über die Vogelwelt seiner Heimat korrigieren, noch fände sich im Deutschen wohl der Name eines Vogels, der (a) in Arizona heimisch wäre und (b) eine Assonanz mit dem Namen »Orin« aufwiese. Das eben ausgebreiete Wissen ist übersetzerisch unnütz. Die Gründlichkeit, mit der ich Realia recherchiere, dient weniger der Übersetzung als der Interpretation: Ich will allen Anspielungen, Kontexten, Konnotationen, Bedeutungsverästelungen und -vernetzungen auf die Schliche kommen, um herauszufinden, was sich im Text »hinter« oder »unter« der Erzählung abspielt. Auf diese Weise bekommt der Roman für mich eine zusätzliche Tiefendimension; es ist also kein primär übersetzerisches, sondern ein literaturwissenschaftliches, ein interpretatorisches Interesse.
9. Maximale Umwege
Weniger grundsätzlich als einfach pragmatisch gesagt: Wörterbücher geben uns nur ein semantisches Minimum an Informationen, Übersetzer brauchen aber Maxima. Also bin ich permanent auf der Suche nach neuen idiomatischen, originellen und stilistischen Ausdrucksmöglichkeiten und frage mich permanent: Was würde ich in einer gegebenen Situation auf deutsch sagen? Erst wenn sich in jedem Satz ein freier, kreativer Umgang mit dem Original ausdrückt, entsteht ein wahrhaft deutscher Text, der nicht mehr auf die Eins-zu-Eins-Beziehungen der Wörterbücher reduzierbar ist.
Eine andere Ausdehnung der Sprache betreiben nichtmuttersprachliche AutorInnen, die »ungefestigt zwischen Sprachen, Kulturen und Systemen leben«, wie die Jury des Internationalen Literaturpreises gerade in einem Kommentar zu ihrer Shortlist formulierte. Dann wird auch der/die ÜbersetzerIn mit anderen Herausforderungen konfrontiert, muss u.U. Brüchigkeiten und Abweichungen von der Standardsprache rekonstruieren, muss sich abseits der ausgetretenen Pfade deutscher Idiomatik Wege durchs Sprachdickicht bahnen.
10. »Kreativität ist machbar, Frau Nachbar«
Man kann Metaphern und Komposita generieren, indem man Begriffe aus verschiedenen Bildbereichen montiert; man kann sprachliche Kohleflöze, Goldadern und Erzminen erbohren, indem man Familio-, Idio- und
Dialekte einbezieht (mein Lieblingsbeispiel sind Wulf Kirstens Gedichte in erdlebenbilder); man kann Zettel und Bleistift dabeihaben, um sich auf der Straße und in der U-Bahn die Umgangssprache der ZeitgenossInnen zu notieren; man kann Autoren wie Arno Schmidt lesen, lesen, lesen, um Techniken wie Wortartwechsel (»bebüchst und bebeilt« – Schwarze Spiegel) oder Anthropomorphose abzukupfern (»manchmal beschlich mich eine schlacksige Windin und zerwarf mir die Haare, wie ne halbwüchsige fleglige Geliebte«, ebd.).
11. SpielereiInnen
Deutsche AutorInnen arbeiten in ihren Texten, wenn sie ästhetisch entsprechend disponiert sind (sind ja nicht alle und müssen es auch nicht sein), genauso kreativ wie ÜbersetzerInnen (wenn deren Originale das erfordern) und denken sich Neologismen aus (»Syntaxmassaker«, Wolfgang Herrndorf), verstoßen gegen grammatische Normen (»Du fehlst mir so. Sehr. Sehrer. Am sehrsten«, Karen Köhler) oder reichern wie Frank Schulz in Kolks blonde Bräute Romane mit Dialektelementen an.
12. Herzensangelegenheiten
Diverse Wörter können für mich aus den verschiedensten Gründen zu Lieblingswörtern werden. Ich mag das Wort »Altweibersommer«, weil es die Stimmung der «schon von Herbstklarheit durchsponnenen Augusttage« einfängt, wie Tellkamp sie im Turm beschreibt, und das Phänomen der Marienseide, dieser in der Luft schwebenden langen Spinnfäden. Ich mag scheinbar sperrige Fremdwörter wie »multifaktorielles Kausalgefüge« (muss ich mal bei Niklas Luhmann aufgeschnappt haben), die komplexe Sachverhalte auf den Punkt bringen. Ich mag Wörter aus rein klanglichen Gründen wie Oskar Pastiors »Opfertopfverstopfer«. Ich mag Kettenkomposita wie »Leinwandgötterbotenstoffe«. Ich mag alte Wörter wie »Grummet«, die zweite oder dritte Mahd in einem Jahr. Ich mag Nonsense-Fremdwörter wie »Paraskavedekatriaphobie«, die Angst vor Freitag, dem 13. usw.
13. Brutto/Netto – Bezüge
Bei Lethems Dissident Gardens beschränkte sich die Recherche auf Alltagsrealia und amerikanische Zeitgeschichte. Bei Infinite Jest kam die Einzelwortrecherche hinzu, also das schiere Ergründen, was Wallace’ Rarwörter überhaupt bedeuten, um sie im nächsten Schritt durch ähnlich seltene und/oder auffällige deutsche Ausdrücke ersetzen zu können. Eine weitere Erschwernis war die Polyphonie des Romans, die Tatsache also, dass alle Figuren auf je eigentümliche Weise sprechen, sowie die diversen Textsorten und Fachsprachen. Bei Finnegans Wake schließlich lässt sich der Aufwand kaum mehr kalkulieren; vor Beginn einer (Pi mal Daumen acht Jahre in Anspruch nehmenden und allenfalls von Jan Philipp Reemtsma zu finanzierenden) Übersetzungsarbeit ist hier zu ergründen, welche semantischen Bedeutungen, musikalischen Anspielungen, literarischen Zitate, historischen Ereignisse, Werbeslogans, Alltagsgegenstände und -praktiken des Irlands der vorletzten Jahrhundertwende usw. usf. überblendet worden sind.
14. Keiner und Viele
Ich habe in den Neunzigern unabhängig von deren Autoren Bücher gekauft, nur weil Harry Rowohlt sie übersetzt hatte, weil ich wusste, dass ich bei ihm immer auf meine komiksüchtigen Kosten kam. (Heute würde ich gegen seine Übersetzungen zaghaft einwenden, dass bei ihm egal war, welcher Autor oben reinging; unten kam immer Harry Rowohlt raus). Auf ähnliche Weise bewundere ich, wie frei Marcus Ingendaay übersetzt, denn wenn ich eine Übersetzung von ihm lese, atme ich spätestens nach zwei Seiten auf, weil die erste Vokabel erschienen ist, die mir klarmacht, ich bin zu Hause, ich bin in Ingendaay-Country: »mandelblütenduftig«, »moppeli- ger Körper«, »knuffige Bambusbudike« (alles auf ein paar Seiten Truman Capote unterstrichen). Frank Heibert ist zum Niederknien; wenn man allein die erste Seite seiner Neuübersetzung von Faulkners The Sound and the Fury aufmerksam liest, kann man sich ein halbes Übersetzungsstudium schenken. Ich verehre Dirk van Gunsteren und Robin Detje, weil Autoren wie Thomas Pynchon und Paul Beatty bei ihnen kulturverlustfrei im Deutschen ankommen.
Und das sind nur erst die Kollegen, die wie ich aus dem Englischen übersetzen. Ich bewundere Susanne Langes Don Quijote, Brigitte Döberts Tutoren, Thomas Weilers Übersetzung von Viktor Martinowitschs Paranoia, alle Übersetzungen von Péter Esterházy und László Krasznahorkai durch Heike Flemming etcetera adcythera.
Vorbilder? Eins: Martin Luther.
15. Lebenübersetzung
Alles Übersetzen ist autobiographisch, denn jedes Wort, das ich hinschreibe, habe ich selbst erlebt: Das »Tütchen« (Unendlicher Spaß 1357) geht auf eine Klassenfahrt nach Passau zurück, bei der ich beim Vorlesen einer Zote aus einem mitgebrachten Witzbüchlein aus Unkenntnis des Worts »Kondom« laut kommentierte, das sei wohl so eine Art Tütchen, was ein homerisches Gelächter im Jungenschlafsaal auslöste und spätabends noch einmal den Klassenlehrer auf den Plan rief.
Ein paar Jahre später: Nach einer Hochzeitsfeier erzählte ich meinen Eltern von der Mutter des Bräutigams, deren Hand ruhig auf der Tischplatte lag, zu zittern begann, wenn sie nach dem Weinglas griff, sich dann aber fest und sicher darum schloss. »Intentionstremor«, kommentierte mein Vater, ein pensionierter Neurologe, lakonisch. Seine Fachsprache hat ein einziges Wort für ein Phänomen, zu dessen Beschreibung ich einen viergliedrigen Satz brauche. Faszinierend. Am liebsten hätte ich sofort Medizin studiert, um der Welt und speziell des Menschen auf diese Weise habhaft zu werden im Wort. Wallace besaß diese Fähigkeit, und sie macht den Unendlichen Spaß so berauschend dicht, konkret, komisch und sinnlich.
1995 habe ich die Erzählung eines irischen Autors für eine Literaturzeitschrift übersetzt – großenteils im Intercity, denn ich wohnte in Berlin und pendelte am Wochenende zu meiner Freundin in Bonn. Die Redakteurin hat mir die Erstfassung der Übersetzung um die Ohren gehauen; ich hatte u.a. »frigid« als »frigide« übersetzt – es ging um eine kalte Statue der Jungfrau Maria am Wegesrand.
16. Explosionen
Eine Lieblingsfigur in Unendlicher Spaß habe ich eigentlich nicht, weil Wallace ja auch negative Figuren voller Empathie schildert; auch in Poor Tony Krause, der immerhin ein Kunstherzen stehlender Junkie ist, wird Mitleid investiert; Figuren werden mit Vorgeschichte ausgestattet. Okay: Ich mag Hal Incandenza, dessen Belesenheit neidisch macht, und Joelle van Dyne, das Schönste Mädchen Aller Zeiten (SCHMAZ), auch weil ich wie sie Filme mag, »wo jede Menge Scheiß in die Luft fliegt« (Unendlicher Spaß 428).
17. »Herr Lehrer, kann ich für die Antwort ein Extrablatt haben?«
In Infinite Jest verdichtet sich das Bewusstsein eines ganzen Kontinents und das Nervensystem einer ganzen Epoche. – Infinite Jest ist eine 1.000 Seiten lange Innenschau der Depression, die depressiven Menschen die Botschaft vermittelt: »Du bist nicht allein.« (Für mich erweckte der Roman den Eindruck, Wallace sei seinen eigenen Dämonen entkommen, auch wenn er ihnen zwölf Jahre später doch erlag.) – Wallace setzt die Entwicklung fort, die Erich Auerbach in Mimesis nachgezeichnet hat, und versucht, Wirklichkeiten tiefer, umfassender und nuancierter darzustellen als seine literarischen Vorgänger. Immer dann, wenn eine Realismusform ihr Innovationspotential ausgeschöpft hat und zur literarischen Konvention erstarrt ist, entwickelt sich ein neuer Realismus, der der Realität auf andere Weise wieder näherzukommen versucht.
18. Jetzt und Warum und Ende
Vor einiger Zeit hätte ich noch gesagt, die Tristesse der deutschen Gegenwartsliteratur bestehe in ihrer zerquälten Anämie, ihrem monadischen, ja tendentiell autistischen Solipsismus. Der Beschränkung auf Innen- und Nabelschau. Der monologischen Perpektive. Dem Fehlen von Dialogen nicht zwischen Figuren, sondern zwischen Weltbildern und Ideologien, deren Konfrontation das Besondere von Romanen (im Gegensatz etwa zu Gedichten) ausmacht. Dem beängstigenden Ausschluss von Welt: »Ich und der leere Bildschirm des Computers, den ich mit Sprache fülle«.
Das war ein einziges großes Vorurteil oder eine unzulässige Verallgemeinerung, die von Autoren und Autorinnen wie Jana Hensel, Wolfgang Herrndorf, Karen Köhler, Sven Regener, Lutz Sei- ler, Saša Stanišić, Uwe Tellkamp und Ulf Erdmann Ziegler (um nur einige von denen zu nennen, die mich in den letzten Jahren begeistert haben) sofort ad absurdum geführt wird.
Warum habe ich überhaupt das Bedürfnis, Gegenwartsliteratur zu lesen? Weil sie Antworten auf die Frage nach dem deiktischen Nullpunkt formuliert: »Was habe ich hier? Und was habe ich hier zu suchen?« (Hans Magnus Enzensberger). Gegenwartsliteratur liefert in Form von sinnlich angereicherten individuellen Lebensentwürfen zeitdiagnostische Standortbestimmungen unterhalb der Ebenen von Politik, Gesellschaft und Kultur. Was erwarte ich von ihr? Rückversicherung über die Welt, in der ich lebe; Instrumente zu deren theoretischer Analyse in erzählender Form; Berichterstattung von den Konfliktlinien der Gesellschaft. Und: Aus was für einem Deutschland glauben SchriftstellerInnen der Gegenwart gekommen zu sein? Wie wird Vergangenheit perspektiviert?
Was man lernen kann? Erdung. Welthaltigkeit. Das Einbauen von Realia. Im Kleinen die Traute, nicht »ein Bier«, sondern »ein Beck’s« zu trinken, nicht »die Nachrichten zu verfolgen«, sondern »auf Spiegel Online zu gehen«. Im Großen den Mut, Tiefenbohrungen in Kollektivmentalitäten vorzunehmen, so wie Richard Ford in Frank erkundet, wie sich Amerikaner fühlen, die durch den Hurrikan Sandy das Dach über dem Kopf verloren haben.
Das Gespräch führte Alexander Rudolfi.
Es geht in dieser Zeitschrift um Zufallsfunde, detektivische Hartnäckigkeit und Glücksfälle, um blitzartige Einsichten und langjährige Faszination ebenso wie um Expeditionen, die kein Ende nehmen wollen. Wir erzählen von Recherchen für literarische, künstlerische, journalistische und wissenschaftliche Projekte. Von den Suchbewegungen, die vor den Texten und Ausstellungen liegen.
Text und Interview erschienen zuerst in Drift – Zeitschrift für Recherchen, Ausgabe 1. Drift ist das Ergebnis eines Projektsemesters am Literaturinstitut Hildesheim und erschien in der Edition Pächterhaus.
Darin liegt sowohl das Positive, als auch das Negative. Es ist unglaublich schön, dass solche Projekte, solche Zeitschriften, solche Realisierungen möglich sind. Gleichzeitig ist es aber unwahrscheinlich, dass diese erste Ausgabe eine große Verbreitung finden, oder es gar eine nächste Ausgabe geben wird. Man bekommt sie, wenn man sich zufällig mal im Büro des Herausgebers Simon Roloff befindet. Aber sonst wird es schwer. Eine Digitalversion könnte kommen, aber keiner weiß, wann. Ich mag das Projekt sehr und besonders dieser Text von Ulrich Blumenbach samt dem Interview hat mich begeistert, so sehr, dass ich ihn allen zugänglich machen wollte. Dies ist dank der Erlaubnis von Simon Roloff hiermit geschehen. Danke! Alle Rechte verbleiben bei ihren Inhabern.
Ich hoffe, ihr habe genauso Freude daran, wie ich. Und vielleicht, wenn ihr ganz nett fragt, bekommt ihr die ganze Zeitschrift. Lohnt sich!
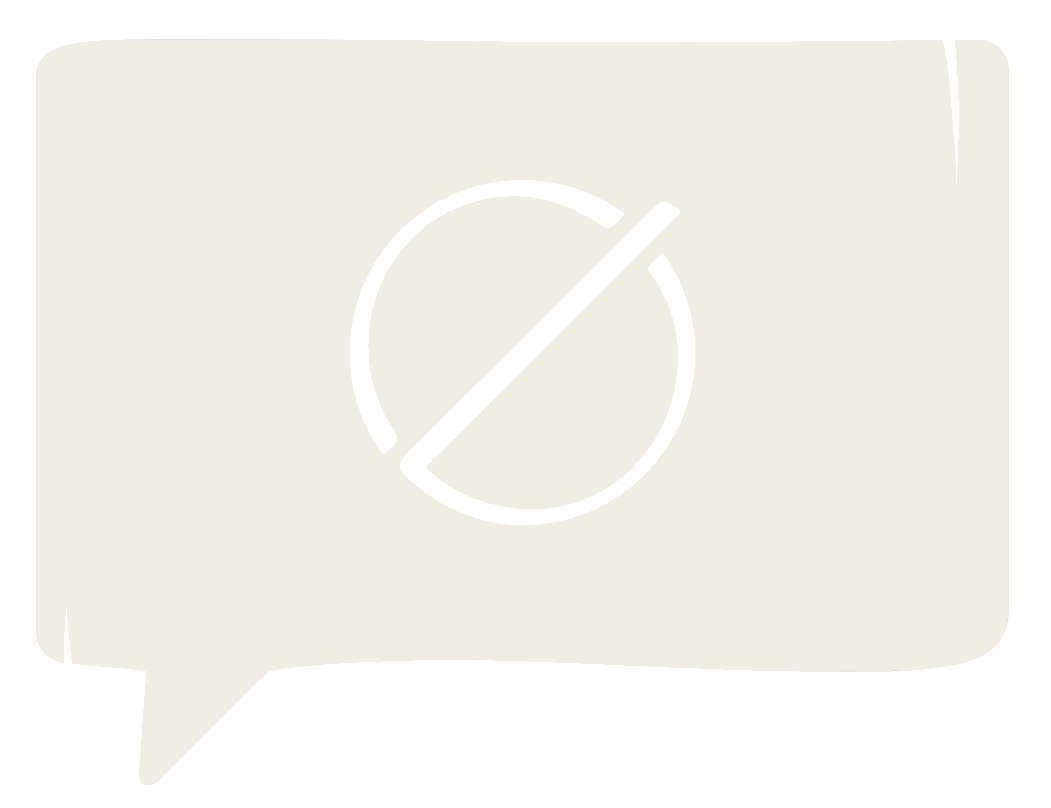
Schreibe einen Kommentar